Totentanz einer Favela
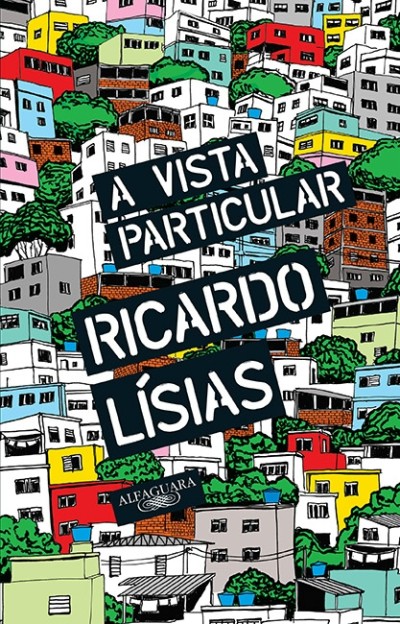
A vista particular, von Ricardo Lísias
rezensiert von Albert von Brunn
José de Arariboia, ein brasilianischer Künstler auf dem Weg zum Ruhm, wird eines Tages dabei gefilmt, wie er splitternackt und in einem seltsamen Samba-Schritt die Rua Sá Ferreira herunterkommt, hinter ihm eine Rotte lärmender Fans. Was aussieht wie ein Werbegag für einen ausgeflippten Künstler, endet am weltberühmten Strand von Copacabana vor dem gleichnamigen Hotel: die Fans bilden einen Kreis um Arariboia und vollziehen ein Art Ritual wie an Silvester zu Ehren der Yoruba-Göttin Iemanjá, es fehlen lediglich die Kerzen, die bei solchen Gelegenheiten auf dem Wasser treiben. Die surreale Szene wird im Internet und in den sozialen Medien ausgeschlachtet und verschafft dem Künstler eine willkommene Publizität, auch wenn seine Galeristin Donatella ihm den Vertrag kündigt. Die Fäden hinter den Kulissen zieht der Händler und Drogenschieber Biribó, der in seinem Studio in der Favela Pavão Pavãozinho aus seinen schmutzigen Geschäften aussteigen und sich als Videokünstler profilieren will. Die Zusammenarbeit dieses ungleichen Paares lässt sich zunächst recht vielversprechend an: aus der Favela mit ihren Baracken, Waffenlagern, kleinen Lädchen, evangelikalen Kultstätten und dem phantastischen Blick auf die Bucht von Guanabara wird ein Kunstwerk, das die Bewohner der reichen Zona Sul in Scharen in die Favela lockt und schließlich sogar den Olympischen Spielen Konkurrenz macht. Was als surreales Happening beginnt, findet ein tragisches Ende: Pavão, Pavãozinho wird als exotische Installation nach Europa exportiert, auf der Biennale von Venedig aufgebaut, während die Gemeinschaft zerfällt und die ehemalige Siedlung ein Raub der Flammen wird. Übrig bleibt lediglich Arariboia, der sich auf Kosten der Favela einen Namen als internationaler Künstler gemacht hat und bereits die nächste Ausstellung im Guggenheim Museum vorbereitet (1).
Immer und überall hat der Mensch versucht, mit den Mitteln der Kunst der Todesangst zu entrinnen. Im 14. Jahrhundert löste die Schwarze Pest eine Art Bewusstseinskrise aus, die eine spezielle Kunstgattung hervorbrachte – den Totentanz. Der Tod als apokalyptischer Reiter über einem Haufen am Boden liegender Menschen, als Megäre mit Fledermausflügeln und als Skelett mit Sense auf dem Rücken – diese Bilder genügten nicht mehr. Die Todesangst wurde zur kollektiven Hysterie, die sich in verschiedenen Formen des Tanzes äusserte, besonders in der spanischen Danza de la muerte von 1520 (2). Der Totentanz war nicht nur eine fromme Ermahnung, sondern auch eine soziale Satire, wie beim kubanischen Schriftsteller Alejo Carpentier, der seinen Totentanz im Roman Die verlorenen Spuren in Blois an der Loire ansiedelt, kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs: »Es war eine Art Scheunenhof, überwuchert von Unkraut, eingesponnen in jahrhundertealte Trauer, und über den Pfeilern war noch einmal das unerschöpfliche Thema abgehandelt: die Eitelkeit allen Prunks, Skelette unter wollüstigem Fleisch, vermoderte Rippen unter (…) dem Kleid des Trommlers, der in diesem Knochenkonzert mit zwei Schienbeinen die Trommel schlug (…). Und die in Beethovens Scherzo so häufig gerührten Pauken gewannen schicksalhafte Aussagekraft, als ich sie mit jener Darstellung im Beinhaus in Blois zusammenhielt, vor dem mich, als ich es verliess, die Nachtausgaben der Zeitungen mit der Nachricht vom Ausbruch des Krieges überraschten« (3).
Wie bei Alejo Carpentier, so besteht auch im Roman von Ricardo Lísias ein enger Zusammenhang zwischen Kunst, Gewalt und Tod. Die surreale Anfangsszene, bei der José de Arariboia den Totentanz im Samba-Rhythmus anführt, endet in einer tragischen Farce: eine junge Katze wird von einem Unbekannten mit Benzin übergossen und angezündet, was eine Brandkatastrophe auslöst und die von ihren Bewohnern verlassene Favela vernichtet.
»Ein Leser aus Rio de Janeiro hat mir gesagt, er finde das Buch urkomisch. Ich nicht«, erklärt Ricardo Lísias in einem Interview (4). Der Titel des Romans verweist auf das zauberhafte Panorama der Bucht von Guanabara, luso-tropikalisches Klischee der Stadt Rio de Janeiro mit Karneval, weißen Stränden und pittoresken Favelas, die sich auch heute noch erfolgreich als Kunst vermarkten lassen (5). Doch dieses Klischee dient lediglich als Feigenblatt für die alltägliche Gewalt, die ständige Präsenz des Todes, der die Gemeinschaft der Favela vernichtet und schliesslich auch im Guggenheim-Museum das letzte Wort behält: »Mit großer Geschwindigkeit rast ein Auto der Militärpolizei aus Rio de Janeiro die Rampe des Museums herunter und schleift eine junge Frau hinter sich her. Cláudia wird die Straße nicht lebend erreichen« (6).
Ricardo Lísias, geboren 1975 in São Paulo, studierte Literatur an der Universität von Campinas (UNICAMP). 2010 gelang ihm mit O livro dos mandarins der Durchbruch und er gewann den Prêmio São Paulo de Literatura. Sein Roman A vista particular (2016), zeitgleich mit den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro erschienen, zeichnet ein ironisch-bissiges Porträt der brasilianischen Gesellschaft von heute.
Albert von Brunn (Zürich)
(1) Lísias, Ricardo.A vista particular. Rio de Janeiro: Alfaguara, 2016.
(2) Guerra, Ramiro. »La Edad Media y la Danza Macabra« in: Revista de Música 2 (1962), SS. 46-51.
(3)Carpentier, Alejo: Die verlorenen Spuren: Roman. Aus dem Spanischen von Anneliese Botond. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1979, SS. 118-119.
(4) Sobota, Guilherme. »Em novo romance, escritor provoca o senso comum nacional com história irônica situada no Rio« in: O Estado de São Paulo 22/10/2016. https://cultura.estadao.com.br/
(5) Monteiro, Pedro Meira. »A vista particular, de Ricardo Lísias« in: ARS 15 (2017), SS. 231-237.
(6) Lísias, Ricardo. A vista particular. Rio de Janeiro: Alfaguara, 2016, S. 126.
***
Ricardo Lísias: A Vista Particular.
Rio de Janeiro: Alfaguara, 2016.
128 páginas
***
Albert von Brunn schreibt regelmäßig für Nova Cultura. Zuletzt rezensierte er Luis S. Krausz: O livro da Imitação e do Esquecimento